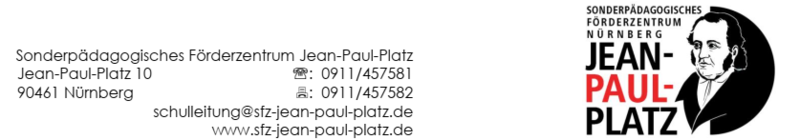
Diese Biographie wurde für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Sichel, Ernst
* 17. 3.1908, Aub
† 11. 5. 1970, Los Angeles, Kalifornien (US)
Am 1. Dezember 1928 wurde Ernst Sichel Mitglied des 1. FC Nürnberg, er spielte Fußball. Sowohl sein Nachname (»Siechel«) als auch sein Geburtsdatum (»18. 3. 1908«) waren auf der Mitgliedskarteikarte falsch angegeben. Als Beruf gab Sichel »Reisender« an. Am 30. April 1933 strich der FCN ihn aus der Mitgliederliste und markierte dies auf seiner Karteikarte mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Den letzten Monatsbeitrag hatte er für Mai 1933 entrichtet. Der Handelsreisende Ernst Sichel wurde am 17. März 1908 in Aub bei Ochsenfurt als jüngster Sohn des Kaufmanns Moritz Sichel und dessen Ehefrau Jeanette »Irmy« (geb. Stein) geboren. Zusammen mit seinen Brüdern Julius und Ludwig wohnte die Familie in Aub. Die jüdische Familie zog am
1. Mai 1924 nach Nürnberg und wohnte in der Moltkestraße 12 und in der Oberen Turnstraße 17. Laut Meldedatei wurde Ernst Sichel am 19. Juni 1935 nach München abgemeldet.
Der NS-Terror in der Reichspogromnacht am 10. November 1938 wütete auch in seiner Heimatstadt Aub. Es gab massive Ausschreitungen und Ernst und Julius Sichel wurden im KZ Dachau interniert. Julius wurde am 6. Dezember 1938 entlassen. Ernst trug die Häftlingsnummer 20.006 und war inhaftiert in der Stube 3 des Blockes 8. Er kam erst am 27. Januar 1939 wieder frei und bereitete seine Emigration nach Großbritannien vor. Vater Moritz Sichel verließ Aub und suchte mit seiner Familie Zuflucht bei Verwandten in Würzburg.
Durch seine Flucht nach England im Juni 1939 überlebte Ernst Sichel als einziger der Familie die Schoah. Am 29. August 1939 heiratete er in London die Tänzerin Margot Menko aus Duisburg, und am 13. Oktober 1939 entschied das Tribunal, dass der Handelsreisende in der Textilbranche ein Fall für Kategorie »C« wäre, und damit weder zu internieren sei noch anderen Einschränkungen unterliegen solle. Sichel lebte zu der Zeit im »Kitchener Camp« bei Richborough, nördlich von Sandwich, in der Grafschaft Kent. Das Kitchener Camp war ein ehemaliges britisches Armeelager aus dem Ersten Weltkrieg, das von Februar 1939 bis Mitte 1940 als Durchgangslager für jüdische Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich genutzt wurde.
1940 wurde Ernst Sichel in Deutschland ausgebürgert. Im Februar 1940 emigrierte er mit seiner Frau Margot in die USA und fuhr mit dem Schiff »Nova Scotia« am 4. Februar 1940 von Liverpool nach Boston. Am 21. Februar 1940 kam er dort an und änderte seinen Vornamen in Ernest. Er zog nach Montgomery, Alabama, und gab dort am 31. Mai 1940 seine Absichtserklärung zur Einbürgerung ab. Als er am 16. Oktober 1940 für die US-Army registriert wurde, wohnte er in Denver, Colorado.
Ernest (Ernst) Sichel starb am 11. Mai 1970 im Alter von 62 Jahren in Los Angeles. Seine Frau Margot verstarb am 19. März 2002 in Glendale, Los Angeles, Kalifornien.
Am 19. November 1939 war Ernst Sichels Mutter Jeanette in Würzburg gestorben. Ernsts Bruder Ludwig musste ab 1939 Zwangsarbeit bei der Stadt Würzburg leisten. Am 27. November 1941 wurde Luwig mit seiner Frau nach Riga-Jungfernhof und von dort in die KZs Stutthof und Buchenwald deportiert. Dort wurde er am 21. März 1945, also wenige Wochen vor Kriegsende, ermordet.
Sein Bruder Julius Sichel, der in München Pharmazie studiert und als Apotheker approbiert hatte, stellte über den Berliner »Hilfsverein für Ju den in Deutschland« beim »Far Eastern Jewish Central Information Bureau, Harbin-Shanghai« Anträge auf Emigration nach Shanghai. Ohne Erfolg. Er wurde Anfang April 1942 mit seiner Frau Erna Josephine von München in das Ghetto Piaski (Polen) deportiert und dort am 8. Mai 1942 ermordet.
Vater Moritz wurde am 23. September 1942 von seiner letzten Würzburger Unterkunft im sogenannten »Judenhaus« in der Bibrastraße 6 aus ins KZ Theresienstadt deportiert und dort am 31. August 1943 im Alter von 72 Jahren ermordet.
An das Schicksal von Ludwig und Moritz Sichel erinnern in Aub zwei »Stolpersteine« des Künstlers Gunter Demnig.
AA; BDJU; GB-GRO; GBM; GB-NAI; https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_ Stolpersteine_in_Aub (aufgerufen am 13. 11. 2021); JG-GSIG; NARA; StadtAN: C 21/X; US-SS
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




