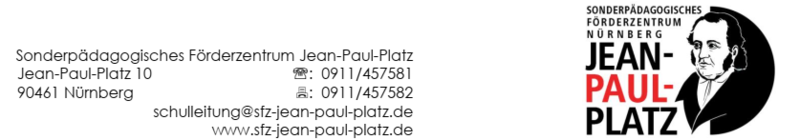
Diese Biographie wurde uns für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Samuel, Herbert
* 18. 5. 1907, Güstrow
† 24. 1. 1992, Blackburn (GB)
In den 1920er-Jahren wurde Herbert Samuel Mitglied des 1. FC Nürnberg, wann genau, ist seiner unvollständig ausgefüllten Mitgliedskarte nicht zu entnehmen. Als Adresse war »Rostock, Emsa-Werke« angegeben. Am 30. April 1933 strich der Club Herbert Samuel aus der Mitgliederliste und markierte dies auf seiner Karteikarte mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Samuel zahlte einen symbolischen Jahresbeitrag in Höhe von fünf Reichsmark, letztmals für 1930.
Der Fabrikant und Jurist Herbert Samuel wurde am 18. Mai 1907 in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, als Sohn des Rostocker Fabrikbesitzers Max Samuel und seiner Ehefrau Berta (geb. Geßner) geboren. Seine jüngere Schwester hieß Käte (* 8. 6. 1910). Die Familie wohnte ab 1921 in Rostock in einer Villa am Schillerplatz 10. Herbert Samuel besuchte die Güstrower Domschule und das Gymnasium in Rostock, wo er 1925 sein Abitur ablegte.
Herberts Vater Max Samuel war Gründer und Besitzer der »EMSA-Werke«, einer florierenden Fabrik für Schuhzubehör und Orthopädie-Artikel, die zeitweise 150 Mitarbeiter hatte und ihre Produkte nach Russland, Skandinavien, England und in die USA exportierte. Max Samuel war nicht nur Industrieller, sondern engagierte sich auch in der Jüdischen Gemeinde. 1923 wurde er Vorsitzender der Gemeinde in Rostock und 1930 Vorsitzender des Israelitischen Oberrates von Mecklenburg-Schwerin. Sein besonderer Schwerpunkt war die Sozialarbeit. In seinen Werken stellte Max Samuel viele Arbeiter ein, die andernorts wegen ihres Glaubens entlassen worden waren und sorgte für Ausreisepapiere sowie Reisegeld.
An einer von seinem Vater erhofften Tätigkeit in den »EMSA-Werken« hatte Herbert Samuel kein Interesse, begann aber ab dem Jahr 1925 in Rostock ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und engagierte sich in der liberalen Deutschen Demokratischen Partei sowie im »Kartell-Convent der Verbindungen deutscher Studenten jüdischen Glaubens«. Im Februar 1926 wechselte er zuerst nach Frankfurt am Main und dann nach Berlin, wo er Rechtswissenschaften studierte.
Drei Jahre später legte Herbert Samuel die erste juristische Staatsprüfung am Landgericht Rostock ab und verfasste im gleichen Jahr seine Doktorarbeit über Urkunden und Wertpapiere, die mit einer Blanko-Unterschrift versehen sind. »Das Blankett im System des Bürgerlichen Gesetzbuches« lautete der Titel seiner 53 Seiten umfassenden Dissertation. 1932 schloss Herbert Samuel sein Studium der Rechtswissenschaften in Rostock mit der zweiten juristischen Staatsprüfung ab.
Wie der Rostocker Herbert Samuel mit dem 1. FC Nürnberg in Berührung kam und warum er beim Club Mitglied wurde, ist nicht bekannt. Immerhin hatte er aber mit dem Allgemeinarzt Dr. Hermann Gessner einen Onkel in Nürnberg, und Herbert Samuel war, so Zeitzeugen, ein »glühender Fußballfan«. Weil er Jude war, wurde er am 30. April 1933 aus der Mitgliederliste gestrichen. Es ist nicht bekannt, wie man beim Club herausfand, dass er jüdischen Glaubens war, denn Samuel war nicht in Nürnberg gemeldet, sondern in Rostock.
Da er als Jude keine Zulassung als Rechtsanwalt bekam, emigrierte er 1934 nach Blackburn in England. Von 1933 bis zu seiner Auswanderung hatte er alle Abteilungen der väterlichen Firma durchlaufen, um in angemieteten Fabrikräumen in Blackburn eine Dependance der Rostocker »EMSA-Werke« zu errichten. Samuel leitete dort das Zweigwerk »The Emsa & Herbert Foot Appliance Co. Ltd.« – die von seinem Vater entwickelte Gummibürste für Wildlederhandschuhe wurde zum Verkaufsschlager.
Am 5. Dezember 1936 heiratete Herbert Samuel in Pancras, Middlesex, Ilse Steinfeld. Sie wurde 1911 im polnischen Katowice geboren und arbeitete seit 1931 als Sekretärin des Londoner Büros des Berliner Tageblattes. Aus Herbert Samuel wurde Gerson Samuel – das Ehepaar Samuel wohnte in Blackburn in der Barker Lane 14.
1938 flüchtete auch Samuels Schwester Käte nach Blackburn. Sie hatte schon im Dezember 1935 ihre Tochter Ruth bei ihrem Bruder in England geboren. Der hatte ihr zu einer Niederkunft in London geraten, was Ruth nach geltendem Recht von Geburt an zur Britin machte. Käte, die als ausländische Mutter einer minderjährigen Britin ein Einreiserecht nach England hatte, kehrte mit ihrer Tochter wieder nach Rostock zurück.
Am 18. August 1937 starb Herbert Samuels Mutter Berta in Rostock. Herbert Samuel reiste mit Frau Ilse ein letztes Mal nach Rostock und nahm unter Gestapo-Aufsicht an der Beisetzung teil. Vater Max beteuerte immer wieder, Deutschland nicht verlassen zu wollen. Im Frühjahr 1938 aber ging er ebenfalls nach Blackburn, seine Fabrik in Rostock wurde unter Zwangsverwaltung gestellt und später »arisiert«. Neben der Mitarbeit in der Fabrik seines Sohnes in Blackburn kümmerte sich Max Samuel auch um verfolgte Juden. Er starb am 2. September 1942 in Blackburn.
Auch Herbert und Ilse Samuel unterstützten viele jüdische und nichtjüdische Emigranten aus dem Familien-, Freundes-, Bekannten- und Rostocker Mitarbeiterkreis. Sie dienten als Erstanlaufstelle, gaben Geld und vermittelten Arbeit und Kontakte. Zeitweise wohnten sie mit bis zu sieben »Gästen« gleichzeitig in ihrer bescheidenen Wohnung in Blackburn. »Herbert Samuel war wie sein Vater Max ein Glücksfall an Hilfsbereitschaft und Warmherzigkeit, ganz der jüdischen obersten Maxime ergeben, das Leben eines jeden Menschen zu heiligen, also ihn im Streit um sein Recht und in Armut zu unterstützen, vor Krankheit, Not und Tod zu retten«, so Ulf Heinsohn vom Max-Samuel-Haus in Rostock.
1943 zogen Herbert und Ilse Samuel in ein kleines Reihenhaus nach Lower Darwen bei Blackburn. Ende der 1950er-Jahre verkaufte Herbert Samuel seine Fabrik und begann englisches Recht zu studieren. Er erwarb die englische Anwaltszulassung und arbeitete fortan als freischaffender Managementberater und Jurist in Großbritannien. Sein Herz schlug für die Blackburn Rovers. Ilse Samuel absolvierte ein Lehramtsstudium für Deutsch, Französisch und Russisch und ging in den englischen Schuldienst.
Mit dem Mauerfall 1989 bot sich Herbert Samuel die Chance, sein Elternhaus in Rostock, eine stattliche Villa am Schillerplatz 10, zurückzuerhalten. Mit Erfolg. Am 22. August 1991 übergab Samuel dann das Haus an die »Stiftung Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur« in Rostock. Das Max-Samuel-Haus ist seitdem Treffpunkt, Kulturstätte und Forschungseinrichtung jüdischer Geschichte und Kultur.
Herbert Samuel verstarb am 24. Januar 1992 im Alter von 84 Jahren in Lower Darwen bei Blackburn. Zu seinem Gedenken verleiht die Stiftung jährlich den »Herbert-Samuel-Preis für besondere Verdienste um die Förderung aktiver Toleranz«.
Antworten von Dr. Ulf Heinsohn, wissenschaftlicher Projektleiter des Max-Samuel-Hauses in Rostock, vom 19., 20. und 21. 1. 2022 auf Anfrage des Autors
DEA; GB-GRO; GB-NAI; http://judeninrostock.de/index.php/de/ (aufgerufen am 13. 1. 2022); US-PL
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




