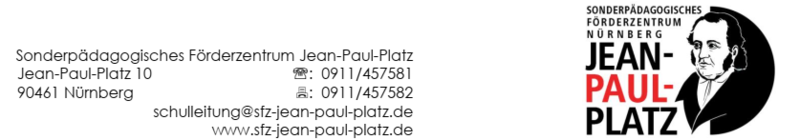
Diese Biographie wurde uns für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Sachs, Camille
* 17. 5. 1880, Würzburg
† 4. 8. 1959, Nürnberg
Am 1. November 1928 wurde der Landgerichtsrat Camille Sachs Mitglied des 1. FC Nürnberg, er gehörte der Abteilung für Leichtathletik an. Am 30. April 1933 strich der FCN ihn aus der Mitgliederliste und markierte dies auf seiner Karteikarte mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Seinen letzten Mitgliedsbeitrag hatte er für das zweite Quartal 1933 entrichtet.
Der Jurist und spätere Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Entnazifizierung Camille Sachs wurde am 17. Mai 1880 als erstes Kind des jüdischen Kaufmanns und Lederhändlers Salomon Sachs und seiner Ehefrau Louise (geb. Offenbacher) in Würzburg geboren. Er war der Älteste, hatte zwei Brüder und eine Schwester, und besuchte das Königliche Neue Gymnasium (heute: Riemenschneider-Gymnasium). Nach dem Abitur studierte er in Würzburg, Berlin und München Rechtswissenschaften und legte 1906 seine juristische Staatsprüfung ab.
Ab 1907 war er als Amtsanwalt in Pirmasens tätig. Am 4. Mai 1908 heiratete er in Wunsiedel Annette Brandenburg. Sie war in Basel geboren und gehörte der Evangelisch-Lutherischen Kirche an, zu der Sachs dann auch konvertierte. Am 26. Februar 1912 kam in Augsburg Sohn Hans auf die Welt, und später noch eine Tochter. 1910 war Sachs Staatsanwalt in Aschaffenburg geworden und ab 1914 war er Richter am Amtsgericht in Nürnberg. Die Familie wohnte in der Krelingstraße 21.
Im Ersten Weltkrieg war Camille Sachs unter anderem in Würzburg und in Augsburg bei der Artillerie, zuletzt war er Regierungskommissar im elsässischen Kanton Rufach. 1919 wurde Sachs zum 2. Staatsanwalt und später zum Landgerichtsrat am Landgericht Nürnberg ernannt. Nach dem Tod seines Vaters am 30. April 1923 holte Sachs 1924 seine Mutter Louise zu sich nach Nürnberg.
Bereits im September 1933 wurde der zur evangelischen Konfession übergetretene Camille Sachs nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wegen »nationaler Unzuverlässigkeit« aus dem Staatsdienst entlassen. Dies geschah trotz seiner Eigenschaft als »Frontkämpfer« im Ersten Weltkrieg und »Altbeamter« und wurde unter anderem mit der Mitgliedschaft in der SPD und der Abstammung aus einem jüdischen Elternhaus begründet.
Sachs bestritt in der Folge als Holzdreher, Bauhilfsarbeiter und Maurer in der Bleistiftfabrik »Lyra« den Lebensunterhalt für sich und seine Familie. Ob Sachs Mitte 1936 die Möglichkeit der Emigration in die USA sondierte, kann nicht geklärt werden. Als er am 16. Juli 1936 in Hamburg das Schiff »Hamburg« mit dem Ziel New York bestieg, verneinte er jedenfalls acht Tage später bei der Ankunft in den USA eine Absicht zur Einbürgerung.
In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurde Sachs von SA-Mitgliedern in seiner Wohnung überfallen und verletzt. Am 10. September 1942 deportierte man seine bei ihm lebende 86-jährige Mutter nach Theresienstadt, sie wurde dort im November 1942 ermordet. Camille Sachs überlebte die NS-Zeit unter dem Schutz der »Mischehe« mit einer Nichtjüdin.
Nach Kriegsende wurde er am 1. August 1945 wieder als Landgerichtsrat eingestellt und vier Monate später zum Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth ernannt. Sachs saß für die SPD im ersten Nürnberger Nachkriegsstadtrat und war Mitbegründer der Vereinigung christlicher Sozialisten sowie 2. Vorsitzender des Verbands geistig Schaffender in der SPD. Außerdem war Camille Sachs Vorsitzender der Spruchkammer Nürnberg V und ab August 1946 Vorsitzender der Berufungskammer Nürnberg. Mit dem »Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus« vom 5. März 1946 übertrugen die Alliierten die Entnazifizierung an deutsche Behörden. Dazu wurden in den drei westlichen Besatzungszonen sog. »Spruchkammern« etabliert. Sie sollten feststellen, ob und wie stark ein Beschuldigter in das NS-Regime und die Ideologie eingebunden war, ob er Mitläufer war oder unbelastet, und ordneten dann entsprechende Sühnemaßnahmen an.
Die ersten politisch motivierten Sprengstoffanschläge nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland mit dem Ziel verübt, die Entnazifizierung zu stoppen. Einer dieser Anschläge traf am 7. Januar 1947 die Nürnberger Spruchkammer. Der Verhandlungsraum in der Keßlerstraße wurde durch einen Sprengsatz – eine mit hochexplosivem Sprengstoff gefüllte Konservendose – schwer beschädigt. Die Militärpolizei führte am nächsten Tag eine Großrazzia in Nürnberg durch und vermutete, dass es sich bei den Attentätern um eine »wohlorganisierte Gruppe früherer Nazis« handeln würde. Am 9. Januar fanden in allen größeren Betrieben Nürnbergs Protestkundgebungen gegen den Anschlag statt.
Am 1. Februar 1947 detonierte dann genau unterhalb des Büros des Spruchkammervorsitzenden Camille Sachs im SPD-Haus in der Karl-Bröger-Straße eine Zeitzünder-Bombe. Der Sprengsatz bestand aus zwei Granaten sowie Geschossen der Wehrmacht und war in nazistische Flugblätter verpackt. Dass in der Entnazifizierung Tätige wie Sachs wenige Monate nach der Kapitulation erneut in Angst leben mussten, war keine Seltenheit. Vielerorts in Bayern und in Baden-Württemberg wurden Spruchkammern angegriffen – aber auch Büros von SPD und KPD oder Betreuungsstellen für NS-Verfolgte. Am 3. Februar 1947 traten in Nürnberg aus Protest gegen das Bombenattentat auf das Büro von Camille Sachs 60.000 Beschäftigte von Großbetrieben in einen Generalstreik. Die Bayerische Regierung lobte eine Belohnung von 100.000 Reichsmark für sachdienliche Hinweise aus. Ende Februar 1947 deckte eine umfassende Geheimoperation der Amerikaner und Briten eine Nazi-Untergrundorganisation auf – Hunderte von Verschwörern wurden damals festgenommen.
Wegen Differenzen mit Alfred Loritz – dem Bayerischen Staatsminister für Sonderaufgaben, wie zum Beispiel der Entnazifizierung – legte Camille Sachs den Spruchkammervorsitz im März 1947 nieder. Nach der Entlassung von Loritz war Sachs im Kabinett von Ministerpräsident Hans Ehard vom 15. Juli 1947 bis 31. März 1950 zunächst Staatssekretär, dann Ministerialdirektor und zuletzt stellvertretender Leiter des Bayerischen Staatsministeriums für Sonderaufgaben. Nach Auflösung des Staatsministeriums wurde Sachs Leiter der Abwicklungsstelle und Ende 1951 schließlich in den Ruhestand versetzt.
1952 wurde Camille Sachs mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Am 4. August 1959 starb er in Nürnberg im Alter von 79 Jahren.
Sein Sohn Hans wurde durch seine Fernsehauftritte von 1955 bis 1989 in Robert Lembkes Quizsendung »Was bin ich« bekannt als Nürnberger Oberstaatsanwalt Hans Sachs.
Gabriel Wetters / Tobias Lotter: Hakennuss und Zirbelkreuz. Rechtsextremismus in Augsburg 1945 – 2000, Heft Nr. 2/2001 der Schriftenreihe des Kurt-Eisner-Vereins für politische Bildung in Bayern e.V., S 40
AA; BDJU; D-BH; http://onlineservice2.nuernberg.de/stadtarchiv/objekt_start.fau?prj= verzeichnungen&dm=Stadtlexikon&ref=6516 (aufgerufen am 12. 11. 2021); https:// zeitgeschichte-online.de/kommentar/was-machte-die-radikale-rechte-gefaehrlich-und- wer-protestierte-gegen-sie (aufgerufen am 12. 11. 2021); Personen-Datenbank zur Geschichte des Bayerischen Parlaments, Stadtlexikon Nürnberg; StadtAN: C 27/II; US-PL; WR
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




