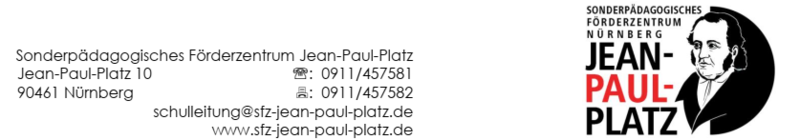
Diese Biographie wurde uns für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Rothschild, Walter Seefried
* 23. 5. 1915, Nürnberg
† 17. 1. 1978, Nürnberg
Am 1. Februar 1931 wurde der kaufmännische Lehrling Walter Rothschild Mitglied des 1. FC Nürnberg in den Abteilungen Leichtathletik und Tennis. Sein Bruder Otto trat neun Monate später dem Verein bei. Am 30. April 1933 entfernte der FCN beide aus der Mitgliederliste und markierte dies auf ihren Karteikarten mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Seinen letzten Beitrag hatte Walter Rothschild für das erste Quartal 1933 entrichtet.
Walter Seefried Rothschild wurde am 23. Mai 1915 in Nürnberg als drittes Kind des jüdischen Kaufmanns Julius Rothschild und seiner katholischen Ehefrau Babette (geb. Schöpplein) geboren. Das älteste der vier Kinder war Anna Barbara (* 19. 5. 1900), dann kamen Ernst (* 18. 5. 1903), Walter und der am 3. April 1918 geborene Otto. Die Kinder waren nach NS-Definition väterlicherseits »Halbjuden« bzw. »jüdische Mischlinge ersten Grades«, in der Meldedatei galten sie als »freireligiös«. Walter besuchte 1930/31 die Klasse 1 B der Höheren Handelsschule für Knaben (heute: Johannes-Scharrer-Gymnasium). Die Familie wohnte in der Sulzbacher Straße 48.
Walter Rothschild verdiente seinen Lebensunterhalt als reisender Textilkaufmann. »Wir haben dich unheimlich gerne, aber du musst jetzt leider gehen«, hätten ihm die Verantwortlichen beim 1. FC Nürnberg Ende April 1933 gesagt, als er von der Mitgliederliste gestrichen wurde. So erzählte er es später seiner Tochter Yvonne. Wie viele andere jüdische Sportler, die aus den bürgerlichen Vereinen ausgestoßen wurden, schloss sich Rothschild einem jüdischen Verein an. Walter ging zum 1934 gegründeten Jüdischen Turn- und Sportverein Fürth, spielte dort Tennis und betrieb Laufsport. 1936 musste sich der Verein in »Jüdischer Sport-Club Fürth« (JSC Fürth) umbenennen. 1937 hatte der »Jüdische Sport-Club Fürth« etwa 600 Mitglieder, seine Leichtathletikmannschaft war bei den Bayerischen Meisterschaften die erfolgreichste. Im Juli 1939 wurde der JSC Fürth aufgelöst.
Von 1939 bis 1940 leistete Rothschild seinen Kriegsdienst bei der Nachrichtentruppe. Dann wurde er zur Wehrmacht einberufen. Zu der Zeit lebte er schon mit Elisabeth Kunzi zusammen. Am 12. Januar 1941 kam Sohn Otto zur Welt, eine Heirat der beiden war jedoch ausgeschlossen, da Walter Rothschilds Lebensgefährtin evangelischen Glaubens war. Elisabeth Kunzi zog mit dem Sohn aufs Land, während Rothschild als Soldat an der Front war.
Am 27. Juni 1944 wurde Walter Rothschild bei einem Fronturlaub von der Staatspolizei Nürnberg verhaftet und am 17. November 1944 als »Politisch – Mischling I. Grades« ins Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert. In der Häftlingskartei wird er mit dem Beruf »Lagerverwalter« geführt. Seine Häftlingsnummer war 2.887, er arbeitete in der Schreibstube.
Laut Meldekarte der Stadt Nürnberg kehrte Rothschild am 25. Juni 1945 vom KZ Buchenwald nach Nürnberg zurück. Nach der Befreiung von Buchenwald hatte er sich in Häftlingskleidung nach Nürnberg durchgeschlagen. Er suchte mit Erfolg nach Elisabeth Kunzi und seinem Sohn Otto. Kurze Zeit später wurde Hochzeit gefeiert und am 30. April 1946 bzw. am 17. Juni 1948 kamen die Töchter Yvonne und Manuela zur Welt.
»Vom KZ-Buchenwald erzählte er nicht viel, aber er hat sich seinen Humor nicht nehmen lassen, er hätte einen guten Kabarettisten oder Alleinunterhalter abgegeben«, erinnert sich seine Tochter Yvonne. »Nach Rückschlägen ist er immer wieder aufgestanden und sein Motto war: Angst habe ich keine, aber ich kann auch schnell laufen.«
Eigentlich wollte Rothschild mit seiner Familie Deutschland in Richtung Spanien verlassen. Dort lebte seine Schwester Anna Barbara, während sein Bruder Ernst nach der Emigration nach Kuba zunächst in Kenia gelebt hatte und dann nach Großbritannien gegangen war. 1949 fuhren die Rothschilds nach Barcelona. Schon nach mehreren Wochen kehrten Walter und Elisabeth Rothschild mit der jüngsten Tochter Manuela nach Nürnberg zurück, Yvonne und Otto blieben bei ihren Verwandten in Spanien.
Walter Rothschild bekam als Wiedergutmachung nach dem Bundesentschädigungsgesetz für jeden Tag im KZ Buchenwald fünf Mark. Er eröffnete zuerst in Erlangen am Bohlenplatz ein Lebensmittelgeschäft und dann einen Stoffladen. Er nannte ihn »Reste-Ecke«, weil er dort Stoffreste verkaufte, die er von Grossisten erworben hatte. Dann ging die Ehe in die Brüche. Mit seinem Laden zog Rothschild nach Nürnberg in die Landgrabenstraße 95. Die Kinder blieben bei der Mutter. Walter Rothschild heiratete erneut und betrieb weiter seine »Reste-Ecke«. An den Wochenenden verfolgte er nahezu jedes Heimspiel des 1. FC Nürnberg im Zabo und im Städtischen Stadion. »Nach Club-Siegen kam er immer vollkommen heiser nach Hause«, so seine Tochter Yvonne.
Am 17. Januar 1978 starb der Textilkaufmann Walter Rothschild in Nürnberg im Alter von 62 Jahren. Sohn Otto lebt heute in Altdorf, die Töchter Yvonne und Manuela in Berlin und in Velburg.
Interview des Autors mit Yvonne Rothschild am 28. 9. 2022
AA; https://juedisch-in-fuerth.repositorium.gf-franken.de/de/startseite.html (aufgerufen am 28. 9. 2022); StadtAN: C 21/IX, C 130, C 27/II, C 27/III Nr. 1098
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




