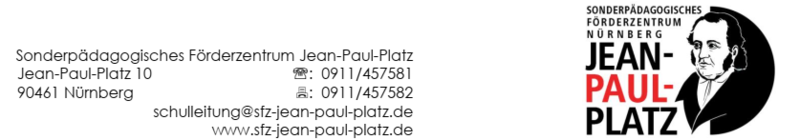
Diese Biographie wurde für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Müller, Ernst Dr.
* 26. 2. 1893, Schmalkalden
† 23. 10. 1953, New York (US)
Müller, Liselotte
* 1. 2. 1906, Nürnberg
† 24. 2. 2007, New York (US)
Am 1. Mai 1928 trat Ernst Müller dem 1. FC Nürnberg bei, drei Jahre später wurde seine Frau Liselotte – wie zuvor ihre jüngere Schwester Margot und ihr Vater Stephan Hirschmann – ebenfalls Club-Mitglied. Sie spielte Tennis, bei ihrem Mann wird in der Mitgliederkartei keine sportliche Abteilung genannt. Am 30. April 1933 entfernte der FCN beide aus der Mitgliederliste und markierte dies auf ihren Karteikarten mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Ihren letzten Mitgliedsbeitrag hatten sie jeweils für das erste Quartal 1933 entrichtet.
Der Frauenarzt Dr. Ernst Müller wurde am 26. Februar 1893 als Sohn der jüdischen Kaufmannsfamilie Josef Müller in Schmalkalden geboren. Müller studierte Medizin und wurde Frauenarzt. Im Ersten Weltkrieg war er dekorierter Frontsoldat und litt als Kriegsfolge unter einer körperlichen Behinderung. Im März 1920 zog er nach Nürnberg und wohnte Am Maxfeld 95. Am 5. Januar 1926 heiratete Müller in Nürnberg Liselotte Hirschmann, die am 1. Februar 1906 als Tochter von Stephan Hirschmann und seiner Frau Martha in Nürnberg geboren wurde.
In einem Interview mit der USC Shoah Foundation bezeichnete Liselotte ihre Familie als »sehr assimiliert, nicht orthodox und sehr modern«. Mit 13 Jahren kam sie auf das Mädchengymnasium und schon in den 1920er-Jahren verspürte sie »antijüdische Vorbehalte von anderen Schülern«.
Liselotte und Ernst Müller zogen Ende Dezember 1929 in ein Jugendstilhaus in der Lindenaststraße 37. Im Oktober 1926 und im März 1931 wurden ihre Söhne Rolf Heinrich und Ullrich geboren.
Ernst Müller hatte eine sehr gut gehende Praxis und war Besitzer und Leiter einer Privatklinik in Nürnberg. Vom für jüdische Ärztinnen und Ärzte ausgesprochenen Kassenarztverbot war Müller wegen seines Fronteinsatzes im Ersten Weltkrieg, für den er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden war, ausgenommen.
Am 1. April 1933 war auch seine Praxis vom Boykott jüdischer Geschäfte, Warenhäuser, Banken, Arztpraxen, Rechtsanwalts- und Notarkanzleien betroffen. Seit diesem Tag wollte Liselotte Müller das Land verlassen: »Ich hatte Angst, denn wir waren gesetzlos.«
Am 12. Juli 1934 schied Müller aus der Bayerischen Ärzteversorgung aus. Für den 16. Juli 1934 ist für die Familie in der Meldekarte »nach Athen abg.(meldet)« eingetragen. Dahinter verbirgt sich für Ernst Müller und seine Familie eine regelrechte Odyssee, bis sie in den USA in Sicherheit waren.
Ursprünglich wollte die Familie nach Palästina auswandern. In einem Bericht der Abteilung für Auswandererberatung des Bayerischen Siedlungswesens vom 5. Juni 1934 wurde vermerkt, dass Müllers »vielfache Bemühungen um Gründung einer neuen Existenz – zuerst in Palästina, dann in Spanien – infolge unüberwindlicher Schwierigkeiten gescheitert« wären. Nun hätte er »die ernsthafte Absicht gehabt, mit seiner Familie nach Griechenland auszuwandern, da er als Nichtarier seine Existenz nicht aufrechterhalten« könne.
Ernst Müller hatte sich demnach die Möglichkeit geboten, zusammen mit einem griechischen Kollegen in Athen eine Privatklinik aufzubauen. »Es wird die Freigabe von 50.000 Reichsmark aus seinem Vermögen für die Auswanderung befürwortet«, heißt es in dem Bericht. Müllers Gesuch verdiene
»besondere Berücksichtigung«.
Also löste Müller seine Privatklinik auf und entrichtete ein Viertel seines Vermögens als Reichsfluchtsteuer. Die Familie fuhr am 16. Juli 1934 mit dem Zug in der 1. Klasse über die Schweiz nach Italien und dann mit dem Schiff nach Athen. Müller studierte vom Sommer 1934 bis August 1935 Griechisch und Französisch und bereitete sich auf das griechische Staatsexamen vor.
»Wir hatten kein Geld, es gab jeden Tag eine Scheibe Brot und eine Tomate«, berichtete Tochter Liselotte. Aber nach dem Examen ging es aufwärts. Ernst Müller arbeitete in einem Athener Krankenhaus und eröffnete eine Praxis. »Viele Patienten wurden Freunde und wir hatten ein fabelhaftes Leben«, so Liselotte Müller.
Das nahm ein jähes Ende, als sich Ende April 1941 die deutsche Wehrmacht bei der Eroberung Griechenlands Athen näherte. Ernst Müller, so berichtete seine Frau im späteren Entschädigungsverfahren, sei von einem Patienten, welcher der britischen Botschaft angehörte, informiert worden, dass ein letzter Konvoi von Piräus nach Palästina auslaufen würde. Nach Zahlung einer großen Summe und der Erledigung aller Formalitäten fuhr die Familie Ende April 1941 mit dem Schiff »Warshowa« nach Palästina und kam nach zehntägiger Überfahrt am 8. Mai 1941 in Haifa an. Per Taxi ging es nach Tel Aviv, wo Martha Hirschmann, die verwitwete Mutter von Liselotte Müller, in einer kleinen Wohnung lebte.
Für die Müllers war Palästina nur eine Zwischenstation, sie wollten in die USA. »Palästina war primitiv, heiß, braun und sandig, und mein Mann konnte nicht als Arzt, sondern nur als Fabrikarbeiter oder Taxifahrer arbeiten«, so Liselotte. Da Ernst Müller auch Arzt von Mitarbeitern der US-Botschaft in Athen war, bekam er mit Hilfe des US-Botschafters entsprechende Visa für die Einreise in die USA.
Ende Juli 1941 begann die Reise, die nahezu ihr gesamtes noch verbliebenes Vermögen kostete: Zunächst ging es mit dem Zug von Jerusalem durch die Wüste nach Suez in Ägypten, und von dort am 29. Juli 1941 mit dem Schiff »SS Kawsar« über Ost- und Südafrika, Brasilien und die Westindischen Inseln in die USA. 70 Tage später, am 6. Oktober 1941, kamen sie als Ernesto, Elise, Rudolf und Ulric Myller in New York an.
»Wir hatten gar nichts mehr, wir lebten alle in einem Zimmer für einen Dollar die Woche.« Mitte März 1942 gab Liselotte Müller ihre Absichtserklä rung zur Einbürgerung in New York ab und erhielt am 11. Februar 1947 die US-Staatsbürgerschaft.
Um sich in den USA als Arzt niederlassen zu können, musste Ernst Müller 1942 und 1943 erneut an die Universität. Seine Frau Liselotte verdiente Geld mit der Herstellung von Klistieren für Frauen, mit Babysitting und als Haushaltshilfe. Ab Ende 1943 praktizierte Ernst Müller wieder als Arzt. »Wir kauften ein Apartment in Manhattan, mein Mann machte viele Entdeckungen in der Onkologie, er wurde Professor, unser Leben wurde wieder gut.«
Am 18. Juni 1953 starb ihr Sohn Ulrich als Leutnant der US-Army bei einem Flugzeugabsturz im Korea-Krieg. Ernst Müller kam darüber nicht hinweg. Er starb am 23. Oktober 1953 in New York im Alter von nur 60 Jahren.
»Ich hatte kein Geld, keinen Sohn und keinen Mann mehr, das war mein Zusammenbruch«, berichtete Liselotte Müller.
Sie stellte am 3. Dezember 1953 beim Bayerischen Landesentschädigungsamt einen Antrag und erhielt insgesamt 50.730 DM zugesprochen. Am 7. Januar 1964 heiratete sie den berühmten New Yorker Wolkenkratzer-Architekten Ely Jacques Kahn, hieß fortan Liselotte Kahn und wohnte in der Park Avenue in New York. Am 13. Dezember 1994 gab sie in New York City der USC Shoah Foundation von Steven Spielberg ein langes Zeitzeugeninterview. Liselotte Müller (Kahn) starb am 24. Februar 2007 im Alter von 101 Jahren in New York. Ihr Sohn Ralph Henry Myller, Architekt und Kinderbuch-Autor, war ein Jahr zuvor am 23. März 2006 in New York gestorben.
HB; https://ia800503.us.archive.org/16/items/ernstmuellercoll01muel/ernstmuellercoll01muel. pdf (aufgerufen am 8. 10. 2021); https://www.geni.com/people/Ulrich-Myller-Mueller/
6000000058014725048?through=6000000058014547063 (aufgerufen am 8. 10. 2021); NA-PH; NARA; StadtAN: C 21/X, C 27/III; USC; US-NY; US-SI
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




