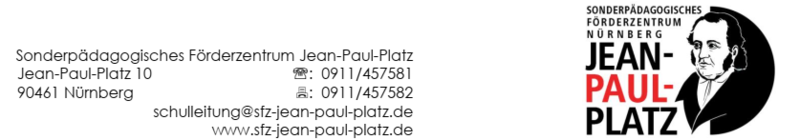
Diese Biographie wurde für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Ilse Bechhold, 1932
Bechhold, llse
* 24. 10. 1917, Nürnberg
† 4. 12. 1992, Litchfield, Connecticut (US)
Ilse Bechhold trat am 1. Mai 1932 als Schülerin in die Tennisabteilung des
1. FCN ein. Am 30. April 1933 strich sie der Club aus der Mitgliederliste und markierte dies auf ihrer Karteikarte mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Als Wohnanschrift gab die Schülerin die Fürther Straße 8 an. Ihren ersten und einzigen Beitrag hatte sie für Mai 1932 bezahlt.
llse Bechhold wurde am 24. Oktober 1917 als jüngstes von neun Kindern der jüdischen Kaufmannsfamilie Abraham und Pauline Bechhold in Nürnberg geboren. Vater Abraham stammte aus Bechhofen und war Kaufmann – zunächst im Güter-, und später im Immobilienhandel. Mutter Pauline (geb. Mann) stammte aus Dottenheim bei Neustadt/Aisch.
Als ihr Vater sich am 19. Dezember 1929 erhängte, war Ilse Bechhold gerade einmal zwölf Jahre alt. »Nürnberg. Mein erstes weißes Zimmer. Schreckliche Alpträume und Ängste. Überall Nazis. Mein Vater begeht Selbstmord ich wurde schnell nach Hamburg gebracht, um bei meiner Schwester zu leben«, schrieb sie. Ilse lebte bei ihrer 14 Jahre älteren Schwester Irma, die sie »Peter« nannte, in Hamburg, und spürte »ein wahnsinniges Verlangen, alles zu verändern und zurückzulassen«.
Sie kehrte 1932 nach Nürnberg zurück, verließ jedoch Deutschland am
22. März 1933 und reiste mit ihrer Schwester Irma über Italien, Spanien und Kuba nach Mexiko. Am 8. August 1933 fuhr sie mit dem Schiff »Oriente« von Veracruz (Mexiko) nach New York. Als Kontaktperson gab sie ihren 17 Jahre älteren Bruder Siegfried an. Dieser war bereits im Mai 1923 von Bremen nach New York emigriert und wurde ein wohlhabender Industrieller. Siegfried stellte das Weingut Fountain Grove nördlich von Santa Rosa – eines der bedeutendsten Weingüter in Kalifornien – auf Rinderzucht um und machte daraus die florierende Grove Fountain Ranch.
In ihrer »Declaration of Intention« vom 22. Oktober 1936 gab Ilse Bechhold an, sie wäre am 12. Juli 1935 mit dem Schiff »Highway« nach New York emigriert und gab als letzten Wohnort vor ihrer Einreise in die USA Montreal, Kanada, an.
In Übersee vermisste sie nicht nur ihre Mutter und ihre Geschwister, sondern auch die europäische Architektur, die europäische Landschaft und die europäische Art, zu leben: »Meine Sehnsucht nach Europa wird fast zur Krankheit. Ich fühle mich gefangen und allein.«
Ende Juni 1937 heiratete sie David Getz und zog nach Allentown, Pennsylvania. Nach 1937 pendelte Ilse zwischen den USA und Europa hin und her, unterbrochen von langen Reisen nach Südamerika und Nordafrika. »Europa. Ich sehe meine Mutter wieder. Ich möchte nicht mehr zurück. Ich werde in Pennsylvania wohnen.« Und 1939: »Ich bin schwanger. Ich muss in Amerika bleiben. Der Krieg bricht aus. Ich fühle mich verlorener als jemals zuvor.«
Am 11. März 1940 kam ihre Tochter Patricia zur Welt. »Ich bin halb verrückt vor Sorge über das Schicksal meiner Familie. Ich helfe, Flüchtlinge unterzubringen.« Im April 1940 wurde Ilse Bechhold in den USA eingebürgert.
»1941: Meine einzige Zuflucht ist New York.«
1942 ging sie mit ihrer Tochter nach Mexiko und begann dort zu malen. 1943 schloss sich Ilse Getz der Art Students League an, sie studierte unter anderem mit George Grosz und Morris Kantor und malte Tag und Nacht. Dann arbeitete sie als freischaffende Künstlerin in New York, wo sie 1945 ihre erste Einzelausstellung hatte. »Ich bin in der Lage, meine Ängste und Hoffnungen zu malen.«
In der Folge lebte und arbeitete sie in Frankreich, Griechenland, Spanien, Portugal, der Schweiz und zeitweise in Brasilien. 1978 sprach sie im Katalog ihrer Ausstellung in der Kunsthalle Nürnberg und im Neuberger Museum of Art in Purchase, New York, von einem »gypsy-like manner of living«. »Ich glaube, dass ich einen Punkt erreicht habe, wo es unwesentlich ist, wo ich lebe. Wo ich mein Nest baue und arbeite, ist mein Zuhause; es ist in mir und ich trage es mit mir, wo immer ich sein muss, in Europa oder Amerika.«
1951 besuchte Ilse Getz Nürnberg zum ersten Mal nach 20 Jahren, 1952 schuf sie ihre ersten großen Leinwandbilder. »New York ist wirklich der aufregendste Platz für mich. Ich habe die größten Räume, in denen ich jemals gemalt habe. Da ich jetzt eine große Wohnung mit Dachgarten und ein Wo- chenendhaus auf dem Lande habe, male ich an beiden Orten. Ich identifiziere mich allmählich mit den New Yorker Künstlern.«
Nach der »German-Forest-Serie«, in der sie ihre Kindheitserinnerungen und -stimmungen zum Ausdruck brachte, entstanden unter anderem die ersten ikonenartigen »Boxes«, eine Serie von weißen, abstrakten Landschaften, die Poetry-Paintings und die Women-in-Windows-Serie. In ihren Gemälden, Collagen und dreidimensionalen Objekten spielten häufig Puppen, Spielkarten, Eier und Vögel eine zentrale Rolle. »Alle Materialien werden ganz unbewusst verwendet. Wenn ich wüsste, warum ich diese Dinge auswähle, oder warum ich von ihnen, über ihren visuellen Anreiz hinaus, angezogen werde, hätte es keinen Sinn mehr, diese Art von Symbolen zu schaffen.«
Nach ihrer Scheidung heiratete Ilse Getz 1958 den Künstler Manoucher Yektai. Die Ehe hielt nur wenige Jahre. 1964 heiratete sie Gibson A. Danes, den Dekan der Yale School of Art and Architecture. Das Paar lebte in New York und Connecticut.
Ilse Getz hatte Ausstellungen in den USA, in Europa und in Israel, 1978 zeigte sie ihre Arbeiten in der Kunsthalle Nürnberg. Der amerikanische Kunstkritiker, Dichter und Pulitzer-Preisträger John Ashbery hielt fest, dass die Werke von IIse Getz »das Wesen ihres Materials übersteigen. Der Geist ist eine neue Art von Materie, geknetet aus Luft, Licht und Objekten, dicht ver streut in starken, einfachen Kompositionen, die uns ein dauerndes Gefühl des Werdens geben.«
Ilse Getz (geb. Bechhold) erkrankte schließlich an Alzheimer und starb zusammen mit ihrem Mann am 4. Dezember 1992 an einer Kohlenmonoxidvergiftung in der Garage ihres Hauses in Litchfield, Connecticut. Ermittlungen des FBI ergaben, dass der 81-jährige Danes seine 75-jährige Ehefrau getötet hatte und dann Selbstmord beging.
Appell, Wolfgang: Juden in Erlangen, Band II, Militärdienst, S. 97 ff.
Ilse Getz – Bilder, Collagen, Konstruktionen, Kunsthalle Nürnberg & Neuberger Museums,
Purchase, New York 197
https://de.findagrave.com/memorial/194229535/pauline-bechhold (aufgerufen am 21. 11. 2021); NA-PH; NARA; StadtAN: C 21/X; US-PL; US-SS
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




