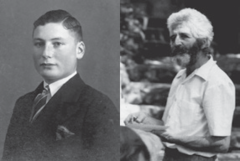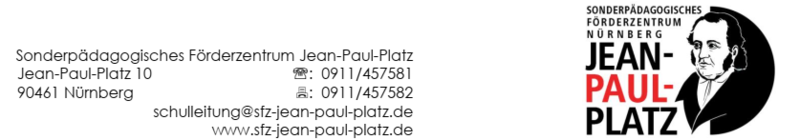
Diese Biographie wurde für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Gebrüder Krakenberger
Krakenberger, Franz
* 11. 5. 1917, Nürnberg
† 23. 3. 2002, Bluffton, South Carolina (US)
Krakenberger, Fritz
* 26. 6. 1921, Nürnberg
† 1. 1. 2009, Schoten (BE)
Krakenberger, Kurt Max
* 17. 9.1913, Nürnberg
† 1. 10. 2001, Truro, Cornwall (GB)
Krakenberger, Willi
* 13. 11. 1918, Nürnberg
† 13. 1. 2016, Berkeley, Kalifornien (US)
Bis auf den jüngsten Sohn Herbert wurden alle Kinder von Alice und Walter Johann Krakenberger schon als Schüler Mitglieder des 1. FC Nürnberg. Kurt war vielseitig sportlich interessiert, er spielte Fußball, Hockey und Tennis und wurde am 1. April 1927 Club-Mitglied. Seine Brüder Franz, Willi und Fritz spielten Tennis und wurden am 1. April 1929, am 1. Mai 1931 und am 1. April 1932 Mitglied des 1. FCN. Am 30. April 1933 entfernte der Club alle vier aus der Mitgliederliste und markierte dies auf ihren Karteikarten mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Den letzten Mitgliedsbeitrag hatten sie für Dezember 1932 bzw. Juni 1933 entrichtet.
Der jüdische Kaufmann Dr. Walter Johann Krakenberger und seine Ehefrau Alice (geb. Tuchmann) hatten fünf Söhne, die alle in Nürnberg geboren wurden: Kurt Max (* 17. 9. 1913), Franz (* 11. 5. 1917), Willi (* 13. 11. 1918), Fritz (* 26. 6. 1921) und Herbert (* 8. 9. 1925). Die Familie wohnte zunächst in der Tiergartenstraße 24 (dann Ernst-von-Rath-Allee) und ab August 1936 in der Lohengrinstraße 13.
Walter, Leopold und Erich Krakenberger waren Besitzer der »Hopfengroßhandlung S. Krakenberger«. Zusammen mit der »Hopfengroßhandlung Hopf & Söhne« und dem »Hopfenhandelshaus Gebrüder Hesselberger« war durch gegenseitige Teilhaberschaft bis 1923 eines der international führenden Unternehmen der Branche entstanden, das so manche Krise im Hopfenhandel überstand.
1936 trennten sich laut Meldedatei die Wege der Familie. Demnach ging zuerst Kurt Max am 2. Januar 1936 nach London, der Handlungsgehilfe Franz wurde Ende Januar 1936 »abgemeldet auf Reisen, New York«, im März 1936 ging Herbert nach Antwerpen, Willi wurde Mitte Juli 1937 in die USA abgemeldet und der kaufmännische Volontär Fritz im Februar 1939 nach Newport.
Am 8. Juni 1938 fuhren Walter Johann und Alice Krakenberger mit dem Schiff »Bremen« in der Touristenklasse von Bremen nach New York. Bei der Ankunft verneinten sie eine Absicht zur Einbürgerung. Sie blieben 16 Tage in New York. Ihre Rückkehr nach Deutschland hatte fatale Folgen.
»Abgemeldet nach Amsterdam« heißt es am 17. Mai 1939 auf der Meldekarte der Eltern. Doch die Flucht in die Niederlande war für Vater Walter keine Rettung. Laut Gedenkbuch des Bundesarchivs wurde er vom Durchgangslager Westerbork am 1. Februar 1944 nach Bergen Belsen deportiert und dort am 1. Juli 1944 für tot erklärt.
Auch Walters Ehefrau und Sohn Herbert wurden nach Bergen-Belsen deportiert. Beide überlebten, weil der Name von Alice Krakenberger auf der Liste von Juden in Bergen-Belsen stand, die im Besitz von lateinamerikanischen Dokumenten waren und sich nach Ansicht der NS-Machthaber damit für einen Austausch gegen im feindlichen Ausland internierte Deutsche bzw. beschlagnahmte Devisen oder Güter eigneten.
Als »Austauschhäftlinge« kamen insbesondere Juden in Betracht, die zum Beispiel über offizielle Einwanderungspapiere der britischen Mandatsbehörde in Palästina verfügten. Sie wurden vorerst von der Vernichtung ausgenommen und ihre Lebensbedingungen waren zunächst deutlich besser als die von Inhaftierten in anderen KZs. So durften sie persönliches Gepäck mitnehmen und Zivilkleidung tragen. Zwischen Juli 1943 und Dezember 1944 wurden mindestens 14.600 jüdische Häftlinge, davon 2.750 Kinder und Jugendliche, in das Aufenthaltslager Bergen-Belsen transportiert.
Insgesamt gelangten nur etwa 2.560 jüdische Häftlinge mit verschiedenen Transporten aus Bergen-Belsen in die Freiheit, darunter Alice Krakenberger und ihr jüngster Sohn Herbert. Sie überlebten das KZ Bergen-Belsen, weil sie gültige Dokumente aus Honduras hatten. Wann und wie sie freikamen, ist nicht bekannt.
Alice und Herbert Krakenberger wohnten dann im Dorf Braunwald im Kanton Glarus. Aus der Schweiz wanderten beide am 30. März 1946 in die USA aus. Für 295 Schweizer Franken ging es mit dem Zug nach Antwerpen und für 835 Schweizer Franken mit dem Dampfer »Joseph Martin« nach New York. Aus Alice Krakenberger wurde Alice Craig – aus Herbert Krakenberger wurde Herbert Walter Craig. Alice Craig starb am 24. Januar 1980 in Rye, Westchester, New York. Herbert wohnte zuletzt in Pinehurst, North Carolina, wo er am 21. Juni 2017 starb.
Was wurde aus den anderen Söhnen? Kurt arbeitete in London bei »Brandon and Nicholson«. Das Tribunal entschied am 19. Oktober 1939, dass er als »Male Enemy Alien« von der Internierung auszunehmen ist. Er nannte sich fortan Richard Kurt Kenber. Am 21. März 1940 heiratete er die Engländerin Eileen Madeleine Baker und hatte ein Kind mit ihr. Richard Kurt Kenber studierte Jura und arbeitete als Rechtsanwalt. Die Familie lebte in Epsom, einer Vorstadt von London in der Grafschaft Surrey, und zog später nach Truro, Cornwall. Dort starb Richard Kurt Kenber am 1. Oktober 2001 im Alter von 88 Jahren.
Sein Bruder Franz entschloss sich zur Emigration in die USA. Er kam am 18. Januar 1936 mit dem Schiff »Columbus« von Bremen aus in New York an, nannte sich fortan Frank Baldwin Craig und erklärte Ende Oktober 1937 seine Absicht, US-Staatsbürger zu werden. Am 18. April 1942 heiratete er die US-Amerikanerin Margaret Gelle Berolzheimer. Das Paar bekam drei Söhne. Frank Baldwin Craig verstarb am 23. März 2002 im Alter von 84 Jahren in Bluffton, South Carolina, USA.
Willi emigrierte am 12. Juli 1937 mit der »Normandie« nach New York. Am 17. Februar 1943 stellte er im Bundesstaat Oregon seinen Antrag auf Einbürgerung und nannte sich nun William Craig. Am 30. August 1939 heiratete er die US-Amerikanerin Julia Rebecca Dwight Wilson. Das Paar wohnte zunächst in Westchester im Bundesstaat New York. Sie bekamen vier Kinder. Später zogen sie nach Berkeley in Kalifornien, wo er als Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt mathematische Logik und Wissenschaftsphilosophie arbeitete. Dort starb William Craig am 13. Januar 2016 im Alter von 97 Jahren.
Fritz macht es wie Kurt. Er emigrierte am 10. Februar 1939 nach Großbritannien und hieß fortan Frederick Graham Henry Kenber. Am 20. Juli 1950 heiratete er die Engländerin Phillida McGlashan. Das Paar bekam zwei Kinder, die Familie lebte in Tunbridge Wells in der englischen Grafschaft Kent. Frederick Graham Henry Kenber arbeitete bei »Unilever« in England und in Belgien. Er starb im belgischen Schoten am 1. Januar 2009 im Alter von 87 Jahren.
GB-EW; GB-GRO; GBN 2002; GB-NAI; https://bergen-belsen.stiftung-ng.de/de/geschichte/ konzentrationslager-1943-1945/ (aufgerufen am 8. 8. 2021); https://www.ancestry.de/ family-tree/person/tree/82335504/person/262181776781/facts?_phsrc=xrp11&phstart= successSource (aufgerufen am 28. 8. 2022); JG-WJC; NARA; S-AA; StadtAN: C 21/X,
C 27/III; US-EK; US-PL; US-SS
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications