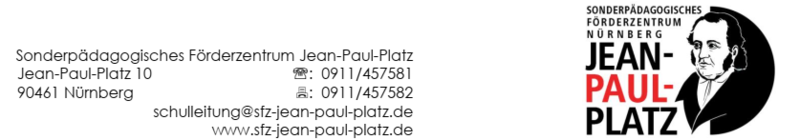
Diese Biographie wurde für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Isner, Justin
* 2. 11. 1889, Hüttenbach
† unbekannt, Auschwitz (PL)
Am 1. September 1922 wurde Justin Isner zunächst passives und 1929 aktives Mitglied des 1. FC Nürnberg, in welcher Abteilung ist nicht bekannt. »Mein Vater war ein großer Fan des 1. FC Nürnberg und so ist meine Mutter mit ihm und mir zu jedem Heimspiel gegangen. Wenn es auch noch so kalt war, wir sind alle drei immer dort gewesen«, erinnert sich seine Tochter Bella Uhlfelder in einem Interview 2007.
Am 30. April 1933 entfernte der FCN Justin Isner aus der Mitgliederliste und markierte dies auf seiner Karteikarte mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Den letzten Beitrag hatte er für Dezember 1932 entrichtet.
Der Kaufmann Justin Isner wurde am 2. November 1889 in Hüttenbach als Sohn des Kaufmanns Eduard Isner und seiner Frau Bella (geborene Rosenfelder) geboren. Er hatte sechs Geschwister. Die jüdische Familie wohnte in Hüttenbach in der Haunachstraße 49.
Im Ersten Weltkrieg kämpfte Justin Isner im II. Ersatzbataillon des 14. Bayerischen Infanterie-Regiments. Später zog er nach Nürnberg und heiratete dort am 17. Juni 1926 Babette Friederike Lutz aus Nürnberg. Der Kaufmann betrieb ein großes Bekleidungsgeschäft mit rund 30 Angestellten in der Adlerstraße 17. Am 30. April 1928 und am 26. Oktober 1929 kamen die Töchter Bella und Ruth zur Welt. Die jüdische Familie wohnte in der Parkstraße 21.
»Meine Eltern, meine Schwester und ich lebten in Nürnberg in recht angenehmen Verhältnissen. Mein Vater hätte niemals daran gedacht, dass ihn das Land, für das er im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, einmal enteignen würde. Nachdem er aber im Mai 1939 plötzlich verhaftet worden war, musste er feststellen, dass wir nicht länger in Deutschland bleiben konnten«, berichtet Tochter Bella bei einem Besuch in Nürnberg.
Als Justin Isner im Mai 1939, also ein halbes Jahr nach der Pogromnacht im November 1938, plötzlich wegen angeblicher »Rassenschande« verhaftet wurde, war ihm klar, dass er Deutschland so schnell wie möglich verlassen musste. Noch am Tag seiner Entlassung kaufte er bei einer Schiffsagentur vier Tickets nach Kuba für je 800 Reichsmark in der Ersten Klasse. Am »11. Mai 1939 ausgewandert nach Havanna« wurde in Isners Meldekarte vermerkt.
Am 13. Mai 1939 ging die vierköpfige Familie mit nur zwei Koffern in Hamburg an Bord der »St. Louis« und wurde nichtsahnend zum Spielball der deutschen Außenpolitik. In einem Rundschreiben vom 25. Januar 1939 mit dem Titel »Die Judenfrage als Faktor in der deutschen Außenpolitik« gab das deutsche Außenministerium das Ziel aus, weltweit antisemitische Stimmungen zu fördern.
Ein Instrument dafür war die »St. Louis« von der Reederei HAPAG. Die 937 Passagiere an Bord des Luxusliners waren fast ausnahmslos deutsche Juden. Am 27. Mai 1939 erreichte das Schiff den Hafen von Havanna. Die Passagiere trugen bereits ihre Koffer an Deck und der St. Louis näherten sich die ersten Boote mit Freunden und Verwandten, die es bereits nach Kuba geschafft hatten. Aber niemand durfte von Bord, da die kubanische Regierung die Touristenvisa der Passagiere nicht akzeptierte. Das Schiff musste in der Bucht vor Havanna ankern. Kapitän Gustav Schröder verhandelte tagelang, konnte jedoch nur erreichen, dass 29 Passagiere an Land gehen durften. Die Familie Isner musste an Bord bleiben – in steter Angst und Unsicherheit.
In Kuba hatten am 8. Mai 40.000 Kubaner, unterstützt von Präsident Federico Laredo Brú, gegen die weitere Einwanderung von Juden protestiert. Drei Tage zuvor hatte der Präsident die Einwanderungsvorschriften für Kuba verschärft. Am 2. Juni 1939 musste die St. Louis daher die kubanischen Hoheitsgewässer wieder verlassen und nahm Kurs auf Florida. Die Stimmung an Bord kippte, ein Emigrant beging Selbstmord.
Vor Miami unterband die US-Küstenwache den Versuch von Kapitän Schröder, einen Teil der Passagiere mit Rettungsbooten an Land zu bringen. Inzwischen waren bereits der Jüdische Weltkongress und auch US-Präsident Franklin Roosevelt persönlich in die Verhandlungen eingeschaltet. Dieser beugte sich am 4. Juni 1939 dem innenpolitischen Druck – im April 1939 hatte das Fortune Magazine eine Umfrage veröffentlicht, wonach 83 Prozent der Amerikaner gegen die Lockerung von Einwanderungsbeschränkungen wären – und lehnte die Einreise der Flüchtlinge ebenfalls ab. Die NS-Presse in Deutschland reagierte mit unverhohlener Häme.
Die »St. Louis« drehte also Richtung Kanada ab, doch auch dort durfte sie in keinen Hafen einlaufen. Auf Anweisung der Reederei musste das Schiff nach Europa zurückkehren – für die Flüchtlinge an Bord eine unerträgliche Vorstellung, in eben dieses Nazi-Deutschland zurückkehren zu müssen, aus dem sie doch gerade fliehen wollten.
Aber kurz bevor das Schiff den Ärmelkanal erreichte, hatten der Jüdische Weltkongress und die HAPAG-Direktion die Regierungen von Belgien, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden zur Aufnahme der Emigranten bewegen können. Die belgische Regierung erlaubte die Landung in Antwerpen. So gingen dort am 17. Juni 1939 rund 900 Passagiere und auch die Familie Isner von Bord.
214 Flüchtlinge wurden von Belgien, 224 von Frankreich, 254 (andere Quellen sprechen von 288; Anm. d. Verf.) von Großbritannien, und 181 von den Niederlanden aufgenommen. Familie Isner gehörte zum französischen Kontingent – und hatte Pech. Mit dem Westfeldzug der Wehrmacht und der Besetzung Belgiens, Frankreichs und der Niederlande geriet die Mehrzahl der von diesen Ländern aufgenommenen Flüchtlinge wieder in den Herrschaftsbereich des Nazi-Regimes. Nur die 254 von Großbritannien aufgenommenen Flüchtlinge waren in Sicherheit.
»Nach fünf Wochen an Bord und zahllosen Enttäuschungen landeten wir schließlich in Frankreich, wo wir die nächsten acht Jahre verbrachten. Kurz nach unserer Ankunft brach der Krieg aus und der Teil Frankreichs, in dem wir waren, wurde von den Deutschen besetzt. Wir lebten nun in ständiger Angst und meist ohne Einkommen«, so Bella Uhlfelder.
Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen schafften die Isners es nicht mehr, den vom NS-Regime besetzten Teil Frankreichs zu verlassen. Die Familie wurde verhaftet und im Lager Drancy bei Paris interniert. Dann wurde Justin Isner abgeholt. »Es war herzzerreißend für uns«, erzählt Bella Uhlfelder. »Ich habe im Leben nie eine schlimmere Szene mitgemacht. Wie konnten uns die Deutschen unseren Vati wegnehmen?! […] Ich glaube, dass meine Mutter von diesem Tag an nicht mehr wirklich gelebt hat.«
Am 6. November 1942 wurde Justin Isner von Drancy aus mit dem Transport Nr. 42 in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert und ermordet. Insgesamt wurden 254 Passagiere der »St. Louis« Opfer der Schoah.
»Mein Vater wurde in Auschwitz ermordet. Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden zwar freigelassen, doch nur um nochmals verhaftet zu werden. Dieses Mal brachte man uns nach Drancy. Wir hatten Glück und überlebten. Im Juli 1947 konnten wir endlich in die Vereinigten Staaten auswandern«, berichtet Bella Uhlfelder.
1947 wanderte Babette Isner mit ihren beiden Töchtern via Göteborg in die USA aus. Am 2. Juni 1947 lief die »Gripsholm« in New York ein. Babette Isner starb am 11. August 1949 in Manhattan. Tochter Bella heiratete zweimal. 2003 besuchte sie auf Einladung des Stadtarchivs ihre Heimatstadt Nürnberg und erzählte die Geschichte ihrer Familie. Sie starb am 29. August 2012 in Stamford, Connecticut. Tochter Ruth heiratete Erich Gustav Kissinger und hatte zwei Kinder, Jacqueline und Ronald Jay. 1996 erzählte sie ihre Geschichte der USC Shoah Foundation. Die Geschwister von Justin Isner überlebten die Shoah in den USA bzw. in Israel.
Die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem ehrte Kapitän Gustav Schröder als »Gerechten unter den Völkern«. Am 8. November 2018 entschuldigte sich Kanadas Premierminister Justin Trudeau im Namen seines Landes für die Zurückweisung der »St. Louis« mit rund 900 jüdischen Emigranten, die aus Nazideutschland fliehen wollten. Hitler habe zugeschaut, wie »wir ihre Visa abgelehnt, ihre Briefe ignoriert und ihnen den Eintritt verweigert haben«, sagte er. »Es gibt kaum Zweifel daran, dass unser Schweigen den Nazis erlaubt hat, ihre eigene ›Endlösung der Judenfrage‹ zu entwickeln.«
Gerhard Jochem / Daniele Lis: Die drei Leben der Bella Uhlfelder, in: Transit – Zeitschrift für Politik und Zeitgeschichte, # 1, Nürnberg 2007
D-BH; GBB; https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Simmelsdorf (aufgerufen am 4. 1. 2022); StadtAN: C 21/X, C 27/III; USC; US-PL
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




