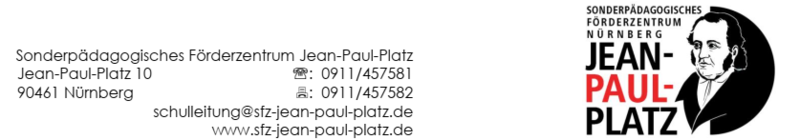
Diese Biographie wurde für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Familie Isner
Isner, Irma
* 1. 5. 1901, Nürnberg
† 1955, Ort unbekannt
Isner, Josef
* 11. 7. 1897, Amberg
† Juli 1976, Cali (CO)
Irma und Josef Isner traten beide am 1. Dezember 1928 in die Tennisabteilung des 1. FC Nürnberg ein. Am 30. April 1933 entfernte sie der Club aus der Mitgliederliste und markierte dies auf ihren Karteikarten mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Irma und Josef Isner hatten ihre Mitgliedsbeiträge bis einschließlich April 1933 bezahlt.
Der Kaufmann Josef Isner wurde am 11. Juli 1897 in Amberg als einziger Sohn des Kaufmanns Benedikt »Benno« Isner und seiner Frau Sallie (geb. Estreicher) geboren. Im Ersten Weltkrieg war er beim 6. Bayerischen Feldartillerie-Regiment in Fürth stationiert.
Der kaufmännische Angestellte und spätere Prokurist Josef Isner heiratete am 17. Juni 1926 in Nürnberg die am 1. Mai 1901 in Nürnberg geborene Irma Merzbacher. Sie war die Tochter von Meier und Clara Merzbacher. Irmas Schwester Gretchen war zweieinhalb Jahre älter.
Irma und Josef Isner bekamen zwei Töchter: Helga Margit (* 14. 7. 1927) und Ruth Eleonor (* 11. 2. 1930). Die jüdische Familie wohnte zunächst in der Zufuhrstraße 20, dann in der Hirtengasse 9 und zuletzt in der Utzstraße 3.
Am 16. April 1936 startete Sallie Isner mit dem Schiff »New York« von Hamburg in die USA. Am 24. April 1936 in New York angekommen, gab sie an, keine Einbürgerung zu beantragen. Sie stellte trotzdem am 14. Juli 1936 einen entsprechenden Antrag, kehrte aber wieder nach Deutschland zurück. Ein schwerer Fehler, wie sich später herausstellen sollte.
Um die Lage in den USA zu erkunden, war auch Josef Isner am 4. März 1937 von Hamburg aus mit der »Deutschland« nach New York gefahren. Er hatte eine Aufenthaltserlaubnis für 75 Tage und verneinte eine Absicht zur Einbürgerung.
Laut Meldekarte wurde die gesamte Familie am 1. Oktober 1938 nach Amsterdam abgemeldet. Im Oktober 1938 emigrierte das Ehepaar Isner mit den 11- und 8-jährigen Töchtern Helga Margit und Ruth Eleonor mit dem Schiff »Champlain« von Le Havre nach New York. Die Familie erreichte New York am 20. Oktober 1938, Josef Isner gab bei der Einreise ein mitgeführtes Barvermögen von 600 Dollar an. Als er im Februar 1942 für die US-Army registriert wurde, wohnte er in Brooklyn und hatte zusammen mit seinem Kompagnon Alois Wurm eine eigene Strickerei gegründet.
Am 2. Mai 1944 wurde Josef Isners Frau Irma eingebürgert. Zu diesem Zeitpunkt war sein Vater schon nicht mehr am Leben. Am 23. September 1942 war Benedikt Isner zusammen mit seiner Frau Sallie mit dem Transport II/26 in das KZ Theresienstadt deportiert worden. Der ursprünglich für Nürnberg geplante Deportationszug ging von Würzburg ab.
Die Verlegung des Abfahrtsbahnhofs erfolgte kurzfristig, weil in Nürnberg nicht mehr genügend zu deportierende Juden lebten. In den 20 Personenwagen wurden insgesamt 680 Juden deportiert, die Isners waren dem Gestapo-Bezirk Regensburg zugeordnet und hatten die Nummern 56 und 57.
Vater Benedikt wurde am 7. Februar 1943 in Theresienstadt ermordet. Mutter Sallie überlebte das KZ. Sie gehörte am 5. Februar 1945 zu den rund 1.200 entlassenen jüdischen KZ-Insassen überwiegend aus Bergen-Belsen, die nach langen Verhandlungen des Internationalen Roten Kreuzes mit der SS in die Schweiz ausreisen konnten. Am 21. Februar 1945 emigrierte Sallie Isner von Marseille nach New York. Dort starb sie am 24. Februar 1953. Zwei Jahre später starb Irma Isner. Josef Isner starb im Juli 1976 im Alter von 79 Jahren im kolumbianischen Cali.
Seine Tochter Ruth Eleonor bzw. Elinore heiratete im Dezember 1950 in New York Ernest Stein und zog dann nach Fort Lee, New Jersey. Tochter Helga Margit heiratete am 2. August 1951 in Manhattan Gerd Sam Bodeen und lebte dann in Paramus, New Jersey.
Aufbau, Jahrgang 11, Nr. 7 (16. 2. 1945), S. 28
AA; D-BH; http://www.lorlebergplatz.de/juden_in_erlangen_II_I-L.pdf (aufgerufen am 28. 8. 2022); https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Simmelsdorf (aufgerufen am 4. 1. 2022); JG-WJC; StadtAN C 21/X 4, C 27/III; US-PL; US-SS
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




