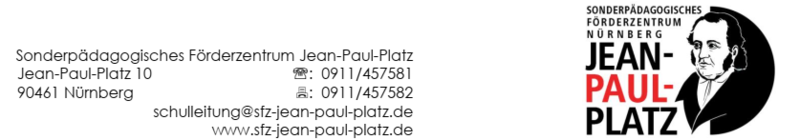
Diese Biographie wurde für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Einstein, Bruno
* 14. 4. 1894, Obbach
† 20. 12. 1943, Billom (FR)
Am 1. Oktober 1926 trat Bruno Einstein dem 1. FC Nürnberg als passives und ab 1. Januar 1929 als aktives Mitglied bei. Am 30. April 1933 entfernte der Club ihn aus der Mitgliederliste und markierte dies auf seiner Karteikarte mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Den letzten Mitgliedsbeitrag hatte er im Oktober 1932 bezahlt.
Der Kaufmann Bruno Einstein wurde am 14. April 1894 in Obbach bei Schweinfurt als drittes Kind des jüdischen Arzt-Ehepaars Dr. Theodor Einstein und seiner Frau Johanna (geb. Harzfelder) geboren. Theodor Einstein hatte in München Medizin studiert und arbeitete als praktischer Arzt in Karbach und in Obbach, sowie im Ersten Weltkrieg als Stabsarzt in Lohr am Main und in Aschaffenburg. Mit Bruno und seinen drei Geschwistern Adele, Julius und Sigurd zog die Familie 1915 nach Nürnberg und wohnte in der Stephanstraße 35 und in der Lohengrinstraße 13.
Der Handlungsgehilfe und spätere Kaufmann Bruno Einstein wohnte in Nürnberg in der Enderleinstraße 13 und dann in der Peter-Henlein-Straße 48. Im Ersten Weltkrieg war er bei der Bayerischen Fliegerersatzabteilung in Schleißheim. Am 15. Dezember 1921 heiratete er die Protestantin Anna Margarete Weiher aus Eschenau. 1933 meldete Bruno Einstein die »Einstein & Wunderlich kaufmännische Vertretungen« als Gewerbe in der Peter-Henlein-Straße 50 an.
Nach Hitlers Machtübernahme verließen Bruno und Anna Margarete Einstein Deutschland. Das Meldeamt der Stadt Nürnberg vermerkte bei ihnen am 16. September 1933: »unbekannt wohin verzogen« – und kurze Zeit später, am 4. Oktober: »abgemeldet unbekannt wohin«. Am 12. April 1937 wurde beiden die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, ihr Vermögen beschlagnahmt und im November 1939 arisiert.
Zu diesem Zeitpunkt war das Ehepaar Einstein längst in Frankreich. Bis auf die älteste Schwester Adele flüchteten alle Einstein-Kinder nach Frankreich. Julius ging nach Clermont-Ferrand und emigrierte im Dezember 1946 in die USA. Sigurd wurde im September 1933 abgemeldet »unbekannt wohin« und starb am 10. Oktober 1934 im Hospital Lariboisière in Paris.
Bruno Einstein ging zur Fremdenlegion, um die französische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Er war vom 13. Dezember 1939 bis zum 24. Oktober 1940 als Freiwilliger bei der Fremdenlegion, zuletzt in Algerien im 1. Regiment in Sidi-Bel-Abbès (letzter Dienstgrad: 2. Klasse, Reserve). Nachdem Einstein von seiner Verpflichtung in der Fremdenlegion entbunden worden war, ließ er sich in Clermont-Ferrand nieder, wo auch sein Bruder Julius mit seiner Frau wohnte. Bruno Einstein zog dann nach Billom in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die Stadt liegt 25 Kilometer von Clermont-Ferrand entfernt und hat heute rund 4.500 Einwohner.
Dort arbeitete Bruno Einstein im Sägewerk, in der Töpferei und in der Tischlerei am Ortseingang von Billom. Diese Betriebe hatte Pierre Pottier gegründet und geleitet, der ab Herbst 1942 Leiter der Widerstandsbewegung im Bezirk Billom war. Er agierte unter dem Pseudonym »Athos« und seine Fabrik wurde zur Keimzelle des Widerstands gegen die Besatzer.
Unter den rund 100 Mitarbeitern waren viele Juden und Flüchtlinge aus Ostfrankreich, dem Elsass und Lothringen, die sich dem »Service du Travail Obligatoire« (STO), dem Pflichtarbeitsdienst des Vichy-Regimes zum Einsatz in der deutschen Kriegswirtschaft, widersetzt hatten. Die Mechanikwerkstatt in Billom rüstete Autos mit Abdeckungen aus, damit darunter versteckt Waffen transportiert werden konnten. Pottier organisierte etwa 30 Mitstreiter, mit denen er ein geheimes Lager für Waffen und Munition aufbaute. Gleichzeitig ermöglichte ihm die Herstellung von Holzbaracken, die an die Organisation Todt – die militärisch gegliederte Bauorganisation im NS-Regime – verkauft wurden, den Erhalt von Führerscheinen und Benzin-Gutscheinen.
In seinem im Jahr 2013 veröffentlichten Buch Billom 1941 – 1943 schrieb Manuel Rispal: »Im Kanton Billom gab es 230 bewaffnete Männer, die in der Lage waren, gegen die deutsche Armee zu kämpfen. Das Ziel der Gestapo war es, sie daran zu hindern, sich zu gruppieren, und sie gefangen zu nehmen.« Die aktivsten Widerstandskämpfer dieser Geheimarmee operierten in der gesamten Auvergne.
Bruno Einstein wurde als Soldat in die Widerstandsgruppe der Pottier-Fabrik aufgenommen und nahm an deren Aktivitäten wie zum Beispiel handstreichartige Überfälle, Schmuggeln von Benzin, oder Transport von Waffen teil. In der Résistance gehörte er zu den Französischen Kräften des Inneren (F.F.I.).
Am 16. Dezember 1943 zerstörten deutsche Soldaten das Netz der in Billom stationierten Geheimarmee. An der Operation waren fast 2.000 Soldaten beteiligt, die von Hugo Geissler befehligt wurden, dem berüchtigten Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes (SD) im Vichy-Regime. Sie errichteten Straßensperren, durchsuchten die Pottier-Fabrik und verhafteten insgesamt 45 Widerstandskämpfer. 20 von ihnen, darunter auch Bruno Einstein und Pierre Pottier, wurden zur Kaserne des 92. Infanterieregiments von Clermont-Ferrand gebracht, dort gefoltert, und am 20. Dezember 1943 auf dem Schießstand des 92. Infanterie-Regiments erschossen.
Bruno Einstein wurde 1947 offiziell der Ehrentitel »Mort pour la France« (»Gestorben für Frankreich«) zuerkannt. Sein Name ist auf der Gedenk-Stele vor der Pottier-Fabrik eingraviert und befindet sich auch auf dem Denkmal für die »Toten des Krieges 1939 – 1945 und des Widerstands« in Billom.
In Billom ist die Erinnerung an die Razzia bis heute lebendig, wie Odette Troubat bezeugt. Sie war damals neun Jahre alt, als ihr Vater Francois, der damalige Bürgermeister des Dorfes Saint-Julien-de-Coppel, am 16. Dezember 1943 verhaftet und vier Tage später erschossen wurde. Bei der Gedenkfeier anlässlich des 70. Jahrestags der Billom-Razzia erinnert sie sich an die Verhaftung ihres Vaters: »Angesichts der Deutschen bat er um seinen Mantel, er ging hinaus. Aber er kam nie zurück.« Sie erklärte: »Diese Menschen wurden getötet, weil sie anderen Widerstandskämpfern oder Flüchtlingen helfen wollten oder weil sie einfach nur einen Funksender besaßen. Einfache Gesten und Risiken für die Bewahrung unserer Werte: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ihr Beispiel ist heute der Grund für unseren Stolz.«
Anfang 1968 kehrte Anna Margarete Einstein nach Nürnberg zurück. Sie lebte im Altenheim in der Veilhofstraße 34. Bei der Meldebehörde gab sie an, dass ihr Mann am 20. Dezember 1943 in Billom »auf dem Schießstand des 92. Infanterie-Regiments« erschossen worden wäre. Diese Angaben wurden laut Vermerk in ihrer Meldekarte durch ein Schreiben der Stadt Billom bestätigt. Anna Margarete Einstein starb am 26. Juni 1971 in Nürnberg.
Rispal, Manuel: Billom 1941 – 1943, Paris 2013
La Montagne vom 21. 12. 2014: Im Gedenken an 20 am 20. Dezember erschossene Widerstands kämpfer
BDJU; D-BH; D-NJ; NARA; Recherche Resistance: https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip. php?article170382 (aufgerufen am 2. 11. 2021); StadtAN: C 21/IX, C 27/X, C 27/III, Nr. 1426, Adressbuch Nürnberg 1928; USHMM
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




