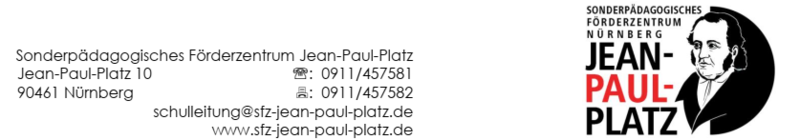
Diese Biographie wurde für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Bukofzer, Max
* 18. 3. 1904, Bayreuth
† 25. 8. 1981, Nürnberg
Am 1. Juli 1921 trat der Kaufmann Max Bukofzer, wohnhaft in der Veillodterstraße 16, dem 1. FCN als passives Mitglied bei. Am 30. April 1933 strich der Club ihn aus der Mitgliederliste und markierte dies auf seiner Karteikarte mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Seinen letzten Jahresbeitrag als passives Mitglied in Höhe von fünf Reichsmark hatte er für das Jahr 1930 bezahlt.
Max Bukofzer wurde am 18. März 1904 in Bayreuth als Sohn von Joseph Bukofzer und seiner Frau Bertha (geb. Zweifaß) geboren. Sein Vater hatte in Nürnberg einen Textilwarenhandel und eine Wäschefabrikation angemeldet. Aus der Ehe von Joseph und Bertha Bukofzer stammten neben Max noch Leo, Herbert und Frieda. Die Ehe ging in die Brüche und am 12. Februar 1922 heiratete der Vater von Max die in Köln geborene Berta Balzer. Aus dieser Ehe ging dann Sohn Heinz Hermann hervor. Die Familie wohnte in der Löbleinstraße 38. Berta Balzer starb im Juli 1928.
Am 29. April 1933 heiratete Max Bukofzer Rosa (Rose) Senninger. Die Katholikin gehörte schon seit 1. August 1931 der Schwimmabteilung des 1. FC Nürnberg an. Bukofzer hatte eine Wäschefabrikation mit Versand in der Königstraße 2 als Gewerbe angemeldet. Das Ehepaar wohnte unter anderem in der Köhnstraße 6, in der Ludwigstraße 3 und zuletzt in der Blumenstraße 9.
Die Ausgrenzung und Verfolgung der Juden bekam Max Bukofzer am Beispiel seines Vaters Joseph hautnah mit. Dieser hatte 1937/38 eine 18-monatige Haftstrafe in Straubing zu verbüßen. Gemäß Urteil des Landesgerichts Nürnberg vom 30. Juni 1939 wurde er wegen Rassenschande zu acht Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt. Als Verbüßungsort war Kaisheim vorgesehen – dort sollte Bukofzer am 12. September 1946 entlassen werden. Doch dazu kam es nicht. Joseph Bukofzer starb am 2. Februar 1942 in der Festung Hohenasperg. Mindestens 101 Gefangene starben dort aufgrund des extrem harten Strafvollzugs.
Zu der Zeit, als sein Vater in Nürnberg wegen Rassenschande verurteilt wurde, hatten Max Bukofzer und seine Frau Rosa (Rose) Deutschland längst verlassen. Laut Meldedatei wurden sie am 22. Januar 1938 nach London und am 16. Dezember 1938 nach New York abgemeldet.
Am 22. Dezember 1938 emigrierte Max Bukofzer mit seiner Frau und 140 Dollar in der Tasche von Hamburg in die USA. Das Schiff »President Roosevelt« kam an Silvester 1938 in New York an. Ein Jahr später gab Bukofzer in Cleveland, Ohio, seine Absichtserklärung zur Einbürgerung (»Declaration of Intention«) ab. Er gründete die Reinigungsfirma »Max Buck Cleaning Supplies« und wurde im Februar 1942 in Cleveland für die US-Army registriert. Bei seiner Bitte um Einbürgerung (»Petition for Naturalization«) erklärte er, fortan Max Buck zu heißen. Am 7. September 1944 erhielt er vom Bezirksgericht in Cleveland die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.
Bukofzers Stiefbruder Heinz Hermann war am 29. November 1941 von Nürnberg nach Riga-Jungfernhof deportiert worden und ist in Bergen-Belsen verschollen. Max Bukofzer (Max Buck) starb am 25. August 1981 im Alter von 77 Jahren in Nürnberg.
Aufbau, Nr. 38 vom 18. 9. 1942, S. 5, und Aufbau, Nr. 42 vom 16. 10. 1942, S. 21 f. GBN 2002; NARA; StadtAN: C 21/X, C 22/II; US-PP; US-SS
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




