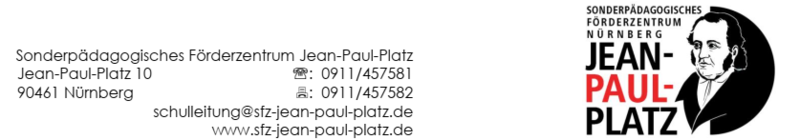
Diese Biographie wurde uns für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Wohl, Paul
* 18. 6. 1887, Nürnberg
† 8. 8. 1942, Queens, New York City (US)
Am 1. Juni 1932 trat Paul Wohl dem 1. FC Nürnberg bei, er spielte Tennis. Am 30. April 1933 strich der FCN ihn aus der Mitgliederliste und markierte dies auf seiner Karteikarte mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Seinen Mitgliedsbeitrag hatte er bis einschließlich Juni 1933 bezahlt.
Der Fabrikbesitzer Paul Wohl wurde am 18. Juni 1887 in Nürnberg als Sohn des jüdischen Kaufmanns Ignatz Wohl und seiner Ehefrau Mathilde (geb. Binzwanger) geboren. Am 20. Juni 1914 heiratete er Emmi Martha Tuchmann aus Nürnberg. Das Paar wohnte in der Emilienstraße 10.
Paul Wohl war Teilhaber der »Vereinigten Margarine-Werke« in der Klingenhofstraße 52 in Nürnberg – einer Fusion der beiden Margarine-Hersteller »Salb & Wohl« (gegr. 1871) und »Heinrich Lang & Söhne« (gegr. 1913). Im Ersten Weltkrieg war Paul Wohl unter anderem bei der Kavallerie im Ersatz-Depot 2 des Bayerischen Chevauleger-Regiments in Regensburg.
Am 4. November 1918 kam in Nürnberg Sohn Heinz zur Welt. Am 26. November 1924 starb Paul Wohls Frau Emmi. Drei Jahre später, im Dezember 1927, heiratete Paul Wohl in Köln Margarete Hirsch, die am 24. September 1928 in Nürnberg Tochter Hilde(gard) zur Welt brachte. Die Familie zog dann in die Hertastraße 19.
Angesichts zunehmender antisemitischer Übergriffe brachten die Eltern am 8. Dezember 1936 Sohn Heinz in die Schweiz in Sicherheit. Er studierte dort Landwirtschaft.
Nachdem in der Pogromnacht das Haus der Familie Wohl völlig verwüstet worden war und im Zuge der Arisierung die beiden jüdischen Teilhaber der »Vereinigten Margarine-Werke Nürnberg« 1939 auf staatlichen Druck ihre Anteile den nichtjüdischen Gesellschaftern überließen, schmiedete Paul Wohl Fluchtpläne. »Er verlor sein Haus, seine Fabrik und alles andere«, erklärte rückblickend seine Tochter Hilde. »Mein Vater war ein versierter Geschäftsmann mit viel Sinn für Humor, er war ein stolzer Bürger von Nürnberg und Deutschland, bis die Nazis kamen.«
Am 19. März 1939 war es dann soweit. Die Familie meldete sich nach Zürich ab. Mit dem Zug ging es in die Schweiz. Doch dort konnten sie nicht bleiben, also ging Paul mit Frau und den zwei Kindern nach England. Während Sohn Heinz in der Landwirtschaft arbeitete, erhielt Paul Wohl keine Arbeitserlaubnis. Nach einem Monat in London zogen sie nach Eastbourne. Am 3. Oktober 1939 wurde Paul Wohl der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt. Als das Tribunal ihn am 16. Oktober 1939 von der Internierung als »feindlicher Ausländer« ausnahm, war er ohne Arbeit. Als Beruf gab er »Margarine-Fabrikant« an.
Auch in England konnte die Familie nicht dauerhaft bleiben, sie wollte in die USA. Das zermürbende Warten auf die Papiere für die Einreise in die USA hatte Anfang 1940 ein Ende: Am 30. Januar 1940 bestiegen Paul Wohl, seine Frau und die beiden Kinder in Liverpool die »Georgic« mit Ziel New York. Dort kamen sie am 11. Februar 1940 mit einem deklarierten Vermögen von 300 Dollar an. Über »Unilever«, die auch Anteile an seinen Margarine-Werken in Nürnberg gehalten hatten, bekam Paul Wohl einen kleinen Verwaltungsjob bei »Lipton Tea«. »Er war glücklich, einen Job zu haben. Wir alle wussten, dass wir ein neues Leben anfangen mAm 8. August 1942 erlag Paul Wohl einer schweren Herzerkrankung. Er starb im Alter von 55 Jahren in Queens, New York. Seine Frau studierte auf der Abendschule und arbeitete als Chemikerin bei »Lipton Tea«. Sie starb 1990.
Pauls Sohn Henry kehrte als Soldat der US-Army von 1941 bis 1944 nach Europa und nach Deutschland zurück. Er studierte Agrarökonomie und etablierte später ein eigenes Bodentestlabor. Henry Wohl starb Ende 2004 in Burlington, Wisconsin.
Tochter Hilde absolvierte eine Ausbildung zur Sportlehrerin, heiratete und bekam zwei Kinder. Sie lebt heute in Madison, Wisconsin.
Antwort von Hilde Adler (geb. Wohl) vom 2. 2. 2022 auf Anfrage des Autors
D-NJ; GB-GRO; GB-NAI; NA-PH; NARA; StadtAN C 21/X, C 27/III; US-NYC; US-PLussten«, so Tochter Hilde.
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




