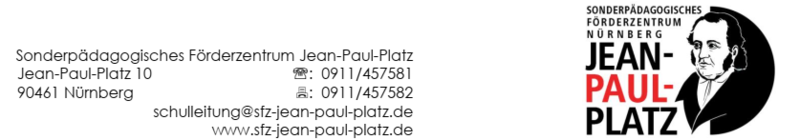
Diese Biographie wurde uns für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:
Wangersheim, Stefan
* 12. 3. 1892, Nürnberg
† unbekannt, (BR)
Stefan Wangersheim trat am 1. Juli 1918 in den 1. FC Nürnberg ein. Der Kaufmann engagierte sich als Schriftführer der Tennisabteilung und als Kassier der Hockey-Abteilung. 1929 wurde er dafür mit dem silbernen Ehrenzeichen des 1. FCN ausgezeichnet. Auch danach kümmerte er sich um die Club-Familie. So beantragte er bei der Mitgliederversammlung im Januar 1931 die Einführung von Gymnastik- und Spielnachmittagen für die Kinder von Mitgliedern und Neumitgliedern »als Grundstock für den Nachwuchs unseres Vereins«.
Am 30. April 1933 strich der Club ihn aus der Mitgliederliste und markierte dies auf seiner Karteikarte mit dem Stempel »30. APR. 1933«. In der Festschrift des 1. FCN zum 40-jährigen Vereinsjubiläum (1940) wurde sein Name neben den von vier anderen jüdischen Mitgliedern sogar aus der Liste der Träger des silbernen Ehrenzeichens getilgt. In der Festschrift zum 50-jährigen Vereinsjubiläum tauchte sein Name dann wieder auf der Liste auf.
Der Journalist und Kaufmann Stefan Wangersheim wurde am 12. März 1892 in Nürnberg als Sohn der jüdischen Kaufmannsfamilie Hermann Wangersheim und seiner Frau Sofia (Sophie) (geb. Erlanger) geboren. Im Ersten Weltkrieg war er unter anderem bei den Sanitätseinheiten der Train-Formationen im Bayerischen Feld-Lazarett 61 eingesetzt. Am 2. Januar 1917 starb sein Vater. Stefan Wangersheim betrieb zunächst 1928 in Nürnberg in der Breiten Gasse 2 und dann 1930 in der Gostenhofer Hauptstraße 61 eine Rosshaarhandlung sowie einen Handel mit Schmirgelpapier, Leinen und Polsterwolle. Er schrieb Berichte über die 1. Mannschaft des 1. FC Nürnberg und über andere
Nürnberger Fußballvereine für den Sportteil des 8UhrAbendblattes.
Am 8. November 1920 heiratete er die in Nürnberg geborene Thekla Rosenberg. Sie war eine exzellente Tennisspielerin, es kann also durchaus sein, dass sie sich beim Club beim Tennisspielen kennengelernt hatten. Von 1922 bis 1928 kamen ihre Kinder Beate Marie, Hans Arnold und Eva auf die Welt.
1930 ließ sich Stefan Wangersheim scheiden. Sohn Hans Arnold wurde am 2. November 1932 nach Fürth abgemeldet, Wangersheims Frau Thekla wohnte seit 14. August 1933 in der Glockenhofstraße 23. Am 29. September 1932 trat sie aus dem 1. FCN aus.
Stefan Wangersheim meldete sich am 9. Juni 1934 nach Basel ab und emigrierte nach Brasilien. Am 30. Juli 1935 heiratete er in Rio de Janeiro Rebecka Tuchler, die am 29. Mai 1926 mit dem Schiff »Sierra Cordoba« von Bremen nach Rio de Janeiro ausgewandert war.
»Dies ist die Geschichte eines Mannes, der in das Auge des Bösen gestarrt hat und das Schicksal von Massenmördern in seinen Händen hielt.« So reißerisch begann eine lange Reportage von Matthew Brzezinski, die am 24. Juli 2005 in der Washington Post publiziert wurde. Darin gab der amerikanische Jurist, Investment-Banker und vormalige Nazi-Jäger Arnold H. Weiss erstmals preis, 1924 in Nürnberg als Hans Arnold Wangersheim geboren worden zu sein. Über seinen Vater, Stefan Wangersheim, erzählte er: »Seine kurzen, einseitigen Kolumnen über das wachsende oder nachlassende Glück der örtlichen Fußballvereine verliehen ihm eine Aura bescheidener Berühmtheit.«
Weiss berichtete, dass sich sein Vater lieber lange in Bierhallen aufgehalten habe, als seine Kinder zu erziehen. Seine Mutter Thekla habe von ihrem Mann für sich und die Kinder keinerlei finanzielle Unterstützung erhalten.
Sein Vater habe »sich seiner ganzen elterlichen Verantwortung entzogen«. Mit ihrem Buchhalterinnengehalt habe seine Mutter ihre drei Kinder nicht ernähren können. Er, Arnold, sei daher von ihr im Alter von acht Jahren ins orthodoxe jüdische Kinderheim nach Fürth geschickt worden. »Die Regeln waren streng, das Essen war lausig, Privatheit existierte nicht, Schläge waren an der Tagesordnung.« Die Trennung von seinen Schwestern bedrückte ihn sehr. Er durfte sie und seine Mutter nur alle paar Monate für einige wenige Stunden sehen. Seine Devise lautete: »Sich einmauern und weder Gefühle noch Schwäche zeigen.« Dazu kamen Schläge von Mitgliedern der Hitler-Jugend, einmal wurde Arnold sogar an einem Laternenmast aufgehängt.
Arnold H. Weiss berichtete, dass er seinen Vater zuletzt 1935 (es müsste eigentlich 1934 gewesen sein, da Stefan Wangersheim im Juni 1934 in die Schweiz ging; Anm. d. Verf.) in Nürnberg getroffen habe: »Wir gingen am Alten Kanal spazieren, er nahm meine Hand und sprach ein Gebet. Das war sehr ungewöhnlich, weil mein Vater kein religiöser Mensch war. Wir werden uns wahrscheinlich nie mehr wiedersehen, sagte er. Ich werde versuchen, Deutschland zu verlassen.«
Kurz danach sei Stefan Wangersheim verhaftet worden und Arnold sah seinen Vater nicht wieder. Er selbst entkam der Schoah 1938 mit einem Kindertransport. Am 18. Februar 1938 erreichte er mit der »Manhattan« von Hamburg aus New York. »13 Jahre alt, nur mit einem kleinen Koffer und fünf Dollar, ich sprach kein Wort Englisch und kannte keine einzige Seele.« Mitte Februar 1943 ging Arnold zur US-Army und gab Ende Mai 1943 seinen Antrag auf Einbürgerung in Janesville, Wisconsin, ab. Er nannte sich fortan Arnold Hans Weiss und war im Zweiten Weltkrieg als Bordschütze auf Boeing-B-17-Bombern, den »fliegenden Festungen«, im Einsatz.
Mit 21 Jahren kehrte Arnold Hans Weiss als Soldat der 45. Division nach Deutschland zurück. Bei der Befreiung von Dachau habe er den Namen seines Vaters auf einer Häftlingsliste entdeckt. In den Archiven der Gedenkstätte findet sich jedoch kein Hinweis auf einen Häftling namens Stefan Wangersheim. Als Nachrichtendienstoffizier des Counter Intelligence Corps hatte Weiss den Auftrag, geflüchtete Nazi-Größen zu verfolgen, festzunehmen und zur Verantwortung zu ziehen. Außerdem spürte er Hitlers »Letzten Willen und politisches Testament« auf. Weiss war als Nazijäger so erfolgreich, dass er ausgezeichnet wurde. »Wir hatten alle Macht, die Deutschen nannten uns die amerikanische Gestapo«, berichtete er nicht ohne Stolz.
Viele Jahre später erfuhr Weiss, dass Stefan Wangersheim überlebt hatte, nach Brasilien emigriert war und dort geheiratet und ein neues Leben angefangen hatte. Seine Mutter und seine beiden Schwestern flohen über England und Portugal in die USA. Die Familie traf sich dann auf verschiedenen Wegen in Wisconsin wieder. Arnolds Mutter Thekla emigrierte mit der 17-jährigen Beate nach Großbritannien. Laut dem Register England und Wales wohnten sie in Barking, Essex, England.
Stefan Wangersheims Tochter Beate Marie heiratete Mitte Oktober 1945 in London und bekam im Juni 1949 Zwillinge. Die Familie wanderte im September 1952 in die USA aus und lebte dann in Milwaukee, Wisconsin. Beate Wangersheim (Holme) starb am 24. Dezember 2007 in Florida.
Stefan Wangersheims zweite Tochter Eva wurde im September 1939 nach Fürth abgemeldet und emigrierte im April 1941 in die USA. Von Lissabon aus kam sie mit dem Schiff »Cuine« in New York an und änderte ihren Namen in Evelyn Perchonok. Sie starb am 9. Dezember 2006.
Stefan Wangersheims Ex-Frau Thekla kam als letzte in die USA. Am
21. März 1946 flog sie von Prestwick in Schottland mit der »American Overseas Airline« nach Chicago. 1949 arbeitete sie als Buchhalterin in Janesville, Wisconsin. Sie starb am 17. September 1983 in Shorewood, Wisconsin.
Für Georg Wangersheim, den Bruder von Stefan, gab es hingegen kein Entkommen. Er wurde am 10. September von Nürnberg nach Theresienstadt deportiert und dort am 29. Januar 1943 ermordet.
Nach seiner Armeezeit studierte Stefan Wangersheims Sohn Arnold H. Weiss Jura an der Universität von Wisconsin. 1992 war er Mitbegründer des global wirkenden Investment-Bankhauses »Emerging Markets Partnership« (EMP). Bei einer Firmenfeier im Sommer 2002 traf er erstmals den Reporter der Washington Post und erzählte ihm zwei Jahre später seine Lebensgeschichte. Arnold H. Weiss starb am 7. Dezember 2010 in Rockville, Maryland.
Matthew Brzezinski: Giving Hitler Hell, in: Washington Post, 24. Juli 2005
AA; Adressbuch Nürnberg 1928; BR-ZB; D-BH; GBN 1998; NA-M; StadtAN: C 21/X, C 27/III; Vereinszeitung des 1. FC Nürnberg 2/1931; US-PL
Quelle:
Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications




